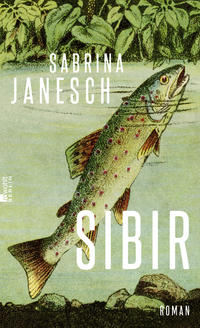Zum Buch:
Wie schon in ihren vorherigen Romanen Katzenberge und Ambra erzählt Sabrina Janesch in _Sibir _einen Teil ihrer Familiengeschichte, und wieder geht es um das Trauma der Vertreibung und Entwurzelung.
Im Winter 1945 fährt ein nicht enden wollender Güterzug quer durch halb Europa bis hinter den Ural nach Kasachstan. Die Insassen – von denen nur ein Bruchteil diese Fahrt überlebt – sind deutsche Zivilisten wie die Familie Ambacher: Vater, Mutter, die Söhne Jakob und Josef, die Eltern des Vaters und seine Schwester. Als der Zug mitten in der endlosen, weißen Fläche der kasachischen Steppe hält, über die ein Schneesturm tobt, ist der kleine Jakob tot, und die Mutter, die verwirrt in die Schneelandschaft läuft, kehrt nicht wieder.
Die Familie hatte lange im polnischen Galizien gelebt und wurde, als im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts das Gebiet an die SU fiel, von den Deutschen ins Wartheland umgesiedelt, einem Gebiet, aus dem die polnischen Bewohner zuvor vertrieben worden waren. Mit dem Einmarsch der Roten Armee 1945 wurden alle Deutschen, die als “Volksfeinde” galten, nach Kasachstan verschleppt.
Mühsam schafft es die Gruppe zu einer kleinen Ansiedlung, in der neben den ansässigen Kasachen und der sowjetischen Verwaltung schon einige Deutsche leben. Dort werden die Ambachers die nächsten zehn Jahre unter ärmlichsten Bedingungen verbringen, unter Hunger und Kälte leiden, immer in Gefahr, wegen irgendeines Fehlverhaltens in den Gulag geschickt zu werden. Offiziell arbeiten dürfen nur zwei Mitglieder, deren Tätigkeit von der Verwaltung als wichtig angesehen wird: Tante Antonia, die ausgebildete Krankenschwester ist, und der Großvater, der als Schreiner arbeitet. Obwohl sich Sohn Josef bald einlebt, einen kasachischen Freund gewinnt und für immer von der unendlichen Steppe fasziniert bleibt, wird er das Trauma der Entwurzelung und eines Lebens in Angst nie wieder loswerden. Selbst Jahrzehnte später – die Familie konnte in den 1950er Jahren in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen – springt er, als es während eines Elternabends heftig an die Klassentür klopft, in Panik aus dem Fenster.
Josefs Tochter Leila – die Ich-Erzählerin des Romans – ist in Deutschland geboren und wächst in einer Siedlung am Stadtrand von Mühlheide auf, in der viele “Rückkehrer” wohnen. Selbst Ende der 1980er Jahre noch fühlt sie sich inmitten der bundesdeutschen “Normalos” als Außenseiterin. Mit ihrem Freund Arnold, der auch aus der Siedlung ist, streift sie in der Gegend herum. Die beiden bauen Höhlen und legen Verstecke an, in denen sie “lebenswichtige Dinge” horten, falls auch für sie einmal die “Schwarze Stunde” kommt, ohne dass sie sich konkret etwas darunter vorstellen können.
“Wofür mein Vater keine Worte hatte, das kleidete er in Geschichten!”, schreibt Leila. Als die zunehmende Demenz des Vaters auch die Geschichten auszulöschen droht, so wie er selbst viele Jahre zuvor alle schriftlichen Zeugnisse aus seiner Jugend ausgelöscht hat, weil er vergessen wollte, beschließt sie, alles aufzuschreiben, was sie über ihn, seine Kindheit und die Familie noch erfahren kann. Sibir ist ein hinreißender Roman, der mit großer Leichtigkeit, einfühlsam und atmosphärisch dicht von Schicksalen erzählt, über die im Nachkriegsdeutschland niemand sprechen konnte und die wohl auch niemand hätte hören wollen.
Ruth Roebke, Frankfurt a.M.