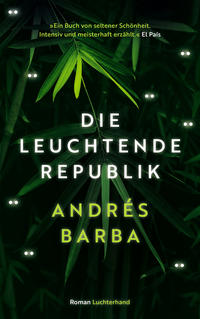Zum Buch:
Ein namenloser Ich-Erzähler rekonstruiert die mittlerweile zwanzig Jahre zurückliegenden Ereignisse in der fiktiven, irgendwo im südamerikanischen Regenwald gelegenen Stadt San Christóbal, an deren Ende 32 Kinder umkamen. Als junger Beamter ist er damals mit seiner Frau und deren Tochter dorthin gezogen. Anfangs tut er sich schwer mit der Gewöhnung an das feuchtheiße, drückende Klima und die langsame Gangart einer solchen Kleinstadt. Aber dann taucht eines Tages eine rätselhafte Gruppe obdachloser Kinder auf. Man sieht sie mal hier, mal da, selten einzeln, immer eher in kleinen Gruppen, offensichtlich auf der Suche nach Nahrung. Sie scheinen eine eigene Sprache zu sprechen, die keiner versteht. Die pure Anwesenheit dieser mysteriösen Kinder schürt erst Misstrauen und Unruhe in der Bevölkerung und irgendwann, nach einem überraschenden Vorfall in einem Supermarkt, dann auch Angst und Wut.
Dass sich einige Kinder der normalen Stadtbevölkerung zu der abgetauchten Gruppe Gleichaltriger hingezogen fühlt, manche sogar davon überzeugt sind, mit den wilden Kindern auf besondere Weise kommunizieren zu können, verschärft die Ablehnung und die Bereitschaft der Erwachsenen, drastische Maßnahmen gegen die Kinder zu ergreifen. Die anarchischen Kinder werden ins Visier genommen und zum Inbegriff des Bösen erklärt. Nach der anfänglichen Ratlosigkeit entwickelt sich rasch eine Dynamik in der Bevölkerung, die in einer koordinierten und dramatischen Hetzjagd gipfelt.
Der Ich-Erzähler sieht im Rückblick mit Erschrecken, wie damals alle Hemmungen der Erwachsenen fielen, jedes Mitgefühl für die Kinder oder auch ein moralisches Verständnis von Schutzbedürftigkeit immer stärker in den Hintergrund trat, um eine potentielle Gefahr im Keim zu ersticken.
Der spanische Autor Andrés Barba, der von einem Dokumentarfilm über eine Gruppe Waisenkinder, die in der Moskauer U-Bahnhof leben (The Children of Leningradsky), zu seinem aktuellen Roman inspiriert wurde, versteht sich auch als philosophischer Autor. Zu Beginn seiner Romane wendet er sich einer philosophischen Frage zu, der er dann beim Schreiben nachgeht. In Die leuchtende Republik greift Barba Jürgen Habermas‘ Konsenstheorie auf, nach der Wahrheit sich durch einen demokratischen Prozess konstituiert. Wahrheit ist also das, worauf sich eine Mehrheit einigen kann. Diese These ist in Zeiten von Fake News und Verschwörungserzählungen hochaktuell und stellt die Frage, ob solche Mehrheitsentscheidungen über das, was Wahrheit ist, immer richtig sind.
Schon weil es sinnvoll ist, sich immer wieder mit dieser grundlegenden Frage zu beschäftigen, vor allem aber wegen der sprachlich dichten und sehr atmosphärischen Erzählweise empfehle ich Andrés Barbas packend erzählten Roman als ausgesprochen lesenswert.
Larissa Siebicke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt