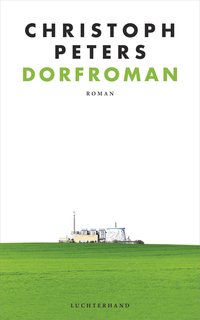Zum Buch:
„Schwarzweiß. Alles, was wichtig ist, ist schwarzweiß. Es ist auf unangenehm riechendes Zeitungspapier gedruckt und wird vor Sonnenaufgang in unseren Briefkasten gestopft, oder es flimmert hinter einer leicht gewölbten Scheibe in einem großen Holzkasten.“ Gleich mit diesem ersten Satz beamt Christoph Peters die Leserin zurück in die siebziger Jahre, die wie die Nachkriegszeit insgesamt in mehr als einer Hinsicht und in vielen Bereichen von Schwarzweiß geprägt waren. Und der kindliche Erzähler, der es auf wenigen Seiten schafft, das Dorf am linken Niederrhein, in dem er mit Eltern und Geschwistern lebt, auf so naive wie genaue und vor allem saukomische Art vorzustellen, hat auch gleich von einer Sensation zu berichten: „Wir sind im Fernsehen!“
Anlass für den Fernsehauftritt ist der geplante Bau des „Schnellen Brüters“, der Wiederaufbereitungsanlage für Plutonium vor dem Dorf Hönnepel bei Kalkar, das hier Hülkendonck heißt und sich, wie die ganze Republik in dieser Frage, in den folgenden Jahren in zwei immer erbittertere gegnerische Lager spaltet. Von diesem Bau und seinen Folgen für das Dorf und den Erzähler erzählt der Dorfroman aus drei verschiedenen zeitlichen Perspektiven: der des Kindes, einem Jungen im Grundschulalter, für den das Wort der Eltern und anderer Autoritäten selbstverständliches Gesetz ist, der des Jugendlichen, der sich dem Protest gegen die Wiederaufbereitungsanlage anschließt, weniger aus politischen Gründen als um der Liebe willen, und dabei alle Freuden und Schmerzen der ersten Liebe erlebt, und schließlich der des Erwachsenen, der aus Berlin für ein paar Tage zu seinen nun achtzigjährigen Eltern fährt und versucht, mit seiner Verantwortung für sie klarzukommen.
Christoph Peters entwirft in Dorfroman ein großes Panorama der alten Bundesrepublik, gesehen durch die Brille eines zunächst noch halbwegs intakten, aber immer mehr zerfallenden dörflichen Lebens, des Lebens in einer engen Gemeinschaft, in der jeder jeden seit Generationen kennt und jedem und jeder dieselben Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, die schon die Urgroßeltern hatten, in der die großen Bauern das Sagen haben, die Landarbeiter nicht zum – streng geregelten – Nachbarschaftssystem gehören und der Kirchgang am Sonntag obligatorisch ist, die aber trotz allem Struktur und Sicherheit verleiht. Ohne jegliche Sentimentalität, ohne die geringste Romantisierung, aber auch ohne jede Verteufelung wird hier ein Bild von „Heimat“ gezeichnet, das sich all dem, was man gewöhnlich darunter versteht, entzieht. Für Christoph Peters ist Heimat schlicht Herkunft, und die bleibt, auch wenn die Heimat schon lange verschwunden, nicht nur, aber auch aufgrund einer Ideologie vom Wert und Nutzen des technisch Machbaren, die sich in der gigantischen Bauruine des Schnellen Brüters manifestiert, der nie ans Netz gegangen und heute zu einem absurden Freizeitpark verkommen ist.
Man könnte diese Ruine für einen Sieg des Protests und ein Scheitern der Ideologie halten, aber gescheitert ist nicht nur die Ideologie, sondern auch die Dorfgemeinschaft, der Lebensentwurf des Erzählers und schließlich dennoch der Protest, wie schon Juliane, die schöne Aktivistin und große Liebe des jugendlichen Erzählers, weiß und damit den Bogen in die Gegenwart schlägt: “Es bringt nichts. Ganz egal, was wir anleiern. Weil es zu spät ist. Einfach zu spät. Nicht nur unsere Eltern und die kapitalistischen Bonzen. Wir alle. Du und ich genauso. Wir kommen da nicht mehr raus. Wenn wir die Gesellschaft ökologisch umbauen, gehen erst mal tausend Firmen pleite, die Leute verlieren ihre Arbeit und wählen irgendwelche Nazis.”
Irmgard Hölscher, Frankfurt