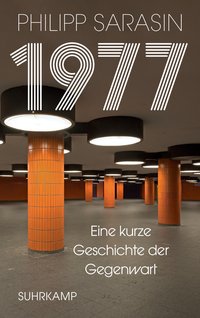Zum Buch:
Bücher mit Jahreszahl-Titeln haben Konjunktur, gleich, ob sie wie 1913 die literarische und künstlerische Blüte kurz vor dem Ersten Weltkrieg, mit 1812 Napoleons Russlandfeldzug oder die vielfältigen Aufstände des Jahres 1956 thematisieren. Was das von dem Schweizer Historiker Philipp Sarasin verfasste Buch 1977 von den anderen unterscheidet, deutet bereits der Untertitel Eine kurze Geschichte der Gegenwart an. Sarasin zeigt anhand von politischen Bewegungen, technischen Neuerungen, philosophischen Diskursen, Architektur, New Age Bewegungen und wirtschaftlichen Strömungen den Beginn von gesellschaftlichen Entwicklungen auf, über die bis heute debattiert wird.
Ausgehend von der einschlägigen These, die in den 70er Jahren eine Art Epochenschwelle des 20. Jahrhunderts sieht, in der der Nachkriegsoptimismus des gesellschaftlichen Fortschritts in der westlichen Welt – mehr materieller Wohlstand, mehr Chancengleichheit, mehr Freiheit – zu bröckeln begann und das Individuum und seine Möglichkeiten der Selbstdarstellung und -optimierung in den Mittelpunkt rückte, greift Sarasin das Jahr 1977 heraus, um diese Entwicklung und ihre Auswirkungen bis heute exemplarisch aufzuzeigen.
In sechs großen Abschnitten behandelt Sarasin unterschiedliche Themenbereiche, an denen er diesen Prozess aufzeigt und dem jeweils ein Nekrolog auf eine berühmte Persönlichkeit vorangestellt ist, die jeweils für diesen Bereich steht und die 1977 gestorben ist. Er beginnt mit Ernst Bloch und entwickelt anhand der Schleyer-Entführung und dem Ende der RAF die Aufsplitterung und den Zerfall der linken Bewegungen. Die – hierzulande kaum bekannte – amerikanische Bürgerrechtlerin Fannie Lou Hamer steht für die Entwicklung des Begriffs der Menschenrechte, den Kampf der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung und den erwachenden Feminismus und seine Ausdifferenzierung. Anais Nin ist die Protagonistin für die radikale Entwicklung hin zum eigenen Erleben, die “Befreiung” der Sexualität und die Hinwendung zu innerer Selbstentwicklung in esoterischen Strömungen. Der Surrealist Jacques Prevert steht am Anfang des Kapitels “Kulturmaschinen”: die Entwicklung des Personal Computers, der Videogeräte und den sich daraus entwickelnden Möglichkeiten, Musik und Videos für die eigenen Zielgruppen zu verbreiten, unabhängig von den großen Musikfirmen. Das letzte Kapitel handelt von Ludwig Ehrhardt und der Entwicklung von der sozialen Marktwirtschaft hin zum Neoliberalismus, von der Soziobiologie-Debatte (Stichwort egoistische Gene) und der Fitnesswelle als körperliche Selbsterfahrung und -optimierung.
1977 war für Sarasin das deutliche Ende der Moderne. Wohin die weitere Entwicklung – vom Verlust der Eindeutigkeiten in der Dekonstruktion und im spielerischen “anything goes” bis zu heutigen Diversitäts- und Identitätsdebatten – führen wird, ist noch unklar und sein Fazit ist entsprechend zwiespältig: “Das Erbe von 1977 ist in diesem Sinne von tiefer Ambivalenz geprägt. Der Gewinn an Freiheit, Diversität und Inklusion, die nicht zuletzt durch die digitale Revolution freigesetzte Pluralität der Stimmen und die im ‘Netz’ sichtbare Vielfalt der Perspektiven können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Doch für den Preis, den wir dafür bezahlen, gilt das auch.”
1977 ist ein fulminant erzähltes, eine unglaubliche Materialfülle aus den unterschiedlichsten populären und wissenschaftlichen Quellen heranziehendes Buch, dessen Lektüre – gerade weil sie nicht in der Darstellung des Gewesenen stecken bleibt, sondern aufzeigt, wohin die jeweiligen Entwicklungen bis heute führen – fesselt und das es durchaus verzeiht, wenn die eine oder andere Seite für den “interessierten Laien” als zu detailreich empfunden und ungelesen überschlagen wird. Wer verstehen will, worin unsere heutigen Debatten ihren Ursprung haben, sollte zu diesem Buch greifen.
Ruth Roebke, Frankfurt