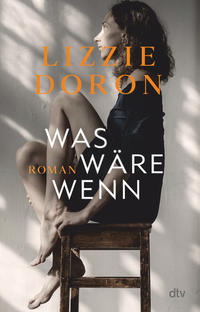Zum Buch:
Ein überraschender Anruf aus einem Hospiz in Tel Aviv reißt die Protagonistin Lizzie aus ihrem gewohnten Alltag: Yigal, ein alter Freund aus Kinder- und Jugendtagen, bitte sie um einen letzten Besuch. Er liege im Sterben. Mit diesem Anruf und dem darauf folgenden kurzen Besuch am Sterbebett beginnt für Lizzie eine Nacht, in der sie von Erinnerungen überschwemmt wird. Erinnerungen an das Aufwachsen in einem Land, das von Patriotismus, Krieg und Heldentum geprägt ist, und mit einer Mutter, die den Holocaust überlebt hat und das Gegenteil der offiziellen Ideologie vom stets kämpfenden und stets siegreichen Zionisten verkörpert. In diesem Zwiespalt schlägt sich Lizzie eindeutig auf die Seite der Patrioten und Soldaten, nimmt es hin, dass schon im Kindergarten ihr Name – Elisabeth – in „Alisa“ geändert wird, spielt mit Freunden und Freundinnen, ebenfalls Kinder von Holocaustüberlebenden, Krieg und lehnt alles ab, was an die „Diaspora“ erinnert. In dieser Kinderbande ist Yigal der Anführer, eindeutig zum Generalstabschef berufen, wird angeschwärmt und angehimmelt, natürlich auch von Lizzie. Als die Mutter die beiden schmusend und knutschend in Lizzies Zimmer erwischt, schmeißt sie Yigal, den „Banditen“, raus, und damit ist erst mal Schluss mit der jugendlichen Affäre und die mögliche Liebe verpasst.
Nicht lange danach macht der Yom-Kippur-Krieg auch Lizzies militantem Zionismus ein Ende – zu viele ihrer Freunde sind gestorben. Yigal gerät in syrische Gefangenschaft, wird schwer gefoltert und kehrt als glühender Pazifist zurück, schreibt Flugblätter und Artikel gegen den Krieg und die Mär von der unbesiegbaren israelischen Armee. Aber anders als früher reißt er seine alten Freunde, die sich überwiegend ins Private zurückgezogen haben, nicht mehr mit, sondern geht ihnen zunehmend auf die Nerven. Bis auf wenige, mehr oder weniger zufällige kurze Begegnungen wendet sich auch Lizzie ab, trotz der Schuldgefühle, die durch das nie ganz abgerissene Band der ersten großen Liebe entstehen.
Was wäre wenn erzählt in kurzen, unverhohlen biographischen flashback-artigen Szenen von den 50er und 60er Jahren bis heute das Leben der zweiten Generation in Israel, das zunächst geprägt war von der Verachtung des Opfernarrativs der Eltern und dann von der desillusionierten Ablehnung des politischen Narrativs vom ständigen Sieg. Was das in Menschen anrichten kann, macht uns Lizzie Doron dank ihrer knappen, glasklaren Sprache und brillanten Komposition verständlich, und dafür kann man sie nur bewundern und ihr danken.
Irmgard Hölscher, Frankfurt a.M.