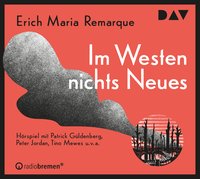Zur Autorin/Zum Autor:
Erich Maria Remarque, geboren 1898 in Osnabrück, ist heute besonders bekannt für seine pazifistisch geprägten Romane, in denen er die Grausamkeiten des Krieges thematisiert. Der berühmteste dieser Romane ist Im Westen nichts Neues (1928). Remarque selbst wurde mit 19 Jahren als Soldat an die Westfront geschickt, wo er bereits einen Monat später durch Granatensplitter und einen Halsschuss verwundet wurde. Nach dem Krieg arbeitete Remarque als Lehrer, dann ab 1921 als Journalist und Schriftsteller. Im nationalsozialistischen Deutschland wurden Remarques Arbeiten als “schändliches und unerwünschtes Schrifttum” verboten und 1933 öffentlich verbrannt. Remarque emigrierte in die Schweiz. Ab 1939 lebte er offiziell in den USA. 1947 erlangte Remarque die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ab 1948 lebte er abwechselnd in den USA und der Schweiz. Erich Maria Remarque starb am 25. September 1970 in seiner Wahlheimat Tessin.