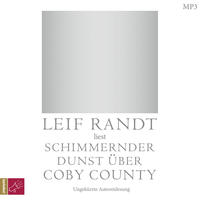Zur Autorin/Zum Autor:
Leif Randt, geboren 1983 in Frankfurt a.M., ist ein deutscher Autor. Bereits erschienen sind die Utopien “Planet Magnon” (2015), “Schimmernder Dunst über CobyCounty” (2011) und der London-Roman “Leuchtspielhaus” (2009). Ausgezeichnet wurde seine Arbeit zuletzt mit dem Erich-Fried-Preis (2016) sowie mit Aufenthaltsstipendien in Japan (2016) und Irland (2019). Seit 2017 co-kuratiert er das PDF- und Video-Label tegelmedia.net.