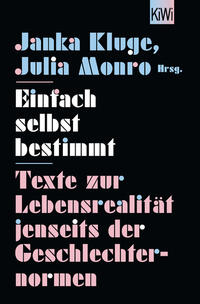
Es reichen heute fünf Buchstaben und ein Sternchen, um auf eine hitzig geführte Debatte zu verweisen: trans*. Dass trans* nicht einfach ein »kontroverses Thema«, sondern die Lebensrealität zahlreicher Menschen ist, wird dabei leicht übersehen.
Seit langer Zeit sind trans* Personen in unserer Gesellschaft psychischer, körperlicher und struktureller Gewalt ausgesetzt. Der unbedingt nötige Abbau dieser Diskriminierungen wird in den letzten Jahren öffentlich diskutiert, und, etwa durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz, sogar konkret in Angriff genommen. Diese gesellschaftlichen und politischen Prozesse führen zu Fragen, Kritik und Gegenwehr.
Umso wichtiger ist Aufklärung: Dieses Buch enthält 20 Texte, von Aktivist*innen, Psycholog*innen, Wissenschaftler*innen und Betroffenen, deren Stärke darin liegt, dass sie ein differenziertes, unaufgeregtes Bild dessen entwerfen, was ein Leben jenseits der Geschlechternormen ist.
(Verlagstext)